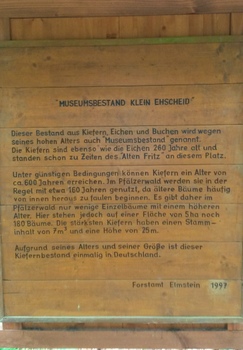|
|
|

|
|
www.wander-mueller.de
|
|
DAV-Wanderungen im Pfälzerwald
Inhalt
Tagesweitwanderungen
60
km-Rundwanderung um Neustadt am
Sonntag, den 7. Mai 2000
58
km-Rundwanderung südwestlich von Neustadt am
Sonntag, den 13. Mai 2001
54
km-Rundwanderung nördlich von Neustadt am
Samstag, den 25. Mai 2002
62
km-Rundwanderung am Samstag, den 15. Mai 2004
52
km-Rundwanderung am
Samstag, den 21. Mai 2005
54
km-Rundwanderung am
Samstag, den 20. Mai 2006
Monatswanderungen
Rundwanderung am 23. April 2017 Neustadt Hbf - Häuselberg - Heidelberg - Hambacher Schloß - Hohe
Loog-Hütte - Neustadt Hbf
Rundwanderung am 7. Mai 2017 Erfenstein - 3-Burgen-Rundweg mit Abstecher Wolfsschluchthütte - Wassersteine - Erfenstein
Rundwanderung am 15. April 2018 Esthal - Brunnenwanderweg West - Museumswald - Wolfsgrube - Esthal
Rundwanderung am 06. Mai 2018 Altes Forsthaus bei Esthal - Brunnenwanderweg Ost - Kl. Pflasterberg - Hengstental - Dörrenberg - Altes Forsthaus
Sonntag, den 7. Mai 2000
60
km-Rundwanderung um Neustadt
Wie
im Vorjahr genossen wir den strahlenden Sonnenschein, allerdings nur
bis zum späten Nachmittag, als wir nur knapp dem Unwetter mit
groschengroßen Hagelkörnern entgingen.
12
Teilnehmer (darunter 9 AV-Mitglieder, 6 von unserer Sektion)
marschierten um 6.00 am Bahnhof Neustadt los. 11 schafften die Tour
mehr oder weniger locker, einer nahm am Forsthaus Heldenstein den
Bus. Der Altersdurchschnitt von 51 Jahren beweist, wie wahr der
Ausdruck von den „jungen Alten“ ist.
Natur
und Kultur durften wir erleben, denn die Strecke führte uns
nicht nur durch die allgegenwärtigen Naturschönheiten des
Pfälzer Waldes, sondern auch an einigen historischen Stätten
vorbei. Zum Auftakt die Wolfsburg, dann der Loblochstein, der
Teufelsfelsen mit der schönen Aussicht und die vom Tal aus zu
erblickenden Ruinen Erfenstein, Spangenberg und Breitenstein waren
die ersten Glanzpunkte vor unserer frühen Mittagsrast am
idyllischen Helmbachweiher. An der Hornesselswiese verließen
wir das liebliche Helmbachtal, um auf teils verschlungenen Wegen zur
Hofruine am Geiskopf, einem der größten untergegangenen
Bauernhöfe im Pfälzer Wald, aufzusteigen.
Nach
einer Nachmittagsrast an der Böchinger Hütte empfing uns
einst blutgetränkte Erde am Fosthaus Heldenstein. Einige
Rittersteine und Denkmäler weisen auf die wechselvolle
Geschichte der verlustreichen Kämpfe um das Schänzel im
Revolutionskrieg 1792-97 hin. Nicht alles konnten wir besichtigen,
aber die Gräben der Schanzen mit den Rittersteinen „Verhau
vor Schanze I“ und „Hauptschanze I“ sowie den
Ritterstein „Stelle um welche General v. Pfau am 13. Juli 1794
fiel“ und die Denkmäler „Heldenstein“,
„Schwedenstein“ und „Österreicher-Denkmal“.
Die
nächsten Stationen, die Lolosruhe mit den „fünf
Steinen“ und der Sattel Suppenschüssel mit den südöstlich
vom Ritterstein teils in Kreisform im Wald versteckt liegenden langen
Steinen dienten gemäß dem Neustadter Hobbyforscher Otto
Schmid schon in der Früh- und Vorgeschichte der
Sonnenbeobachtung zur Festlegung von Kalenderdaten. Wir passierten
die Ruine der Hütte an der Hüttenhohl, von der Walter
Eitelmann in seinem „Rittersteinbuch“ ausführt, daß
sie irrtümlich als „Römerwachtstube“ bezeichnet
werde, in Wahrheit jedoch aus dem Mittelalter stamme.
Vorbei
am Bürgermeisterstein (Loogfelsen mit eingravierten Hausmarken)
erreichten wir die Hohe Loog-Hütte, wo freundliches
Hüttenpersonal uns noch nach Feierabend „vorm Verdursten
rettete“. Die letzte historische Stätte dieses langen
Wandertages, der Franzosenfels auf dem Nollenkopf, erinnerte uns an
die wundersame Errettung Neustadts durch Kunigunde Kirchner, die 1688
den französichen Kriegskommissar de Werth mit ihrer Schönheit
bezirzte. Die letzte schöne Aussicht genossen wir vom
Zigeunerfelsen. Die Abendsonne zauberte von der durch den
Gewitterregen dunstverhangenen Landschaft ein friedliches Bild. Auch
konnten wir dank der neuerlichen Freilegung der Ringmauern die
beachtlichen Ausmaße der Wolfsburg bestaunen. Der Kreis schloß
sich; wir erreichten den Bahnhof um 20.30 Uhr.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Sonntag, den 13. Mai 2001
58
km-Rundwanderung südwestlich von Neustadt
Zum
dritten Mal 12 Teilnehmer, darunter 3 „Power-Frauen“. Zum
ersten Mal kein Ausfall, obwohl diese Tour mit rund 2.300 Metern
Höhendifferenz eine echte Herausforderung war. Kein Wunder, da
die Besteigung von 5 Bergen auf dem Programm stand, darunter die
beiden höchsten des Pfälzerwaldes, Kalmit (672,6 m) und
Kesselberg (661,8 m), und der vierthöchste, der Hochberg (635,3
m). Bei dieser Leistung möchte ich mal die Teilnehmer aus
unserer Sektion nennen: Isolde und Lothar Deck, Barbara Lang, Robert
Nabinger, Thomas Oppenheimer, Winfried Stöckl und meine
Wenigkeit. Wir hatten jedoch ideale Wettervoraussetzungen: Herrlicher
Sonnenschein, nicht zu heiß, trockene Luft, und meistens wehte
ein leises Lüftchen.
Obwohl
für Pausen nur wenig Zeit blieb, konnten wir uns einiges
anschauen: Am Königsberg die „Bruderhäuschen“
genannte Eremitage wohl aus dem 16. Jahrhundert, den Eingang zur 40 m
langen und 12 m tiefen Heidenlochhöhle, von der ich einen
Querschnitt zeigen konnte. Lothar Deck führte uns noch zum
„Dampfloch“, aus dem bei niedrigen Temperaturen warme
Luft ausströmt, die durch Kondensation eine gut sichtbare
Dampfsäule bildet. Obwohl von den Hünengräbern und
Ringwällen auf dem Königsberg nicht mehr viel zu sehen ist,
beeindruckt die Tatsache, auf einem so historischen Boden zu stehen.
Immerhin geht diese Besiedlung bis in die Hallstattzeit (1200 bis 550
v.Chr.) zurück. Vermutlich residierte hier sogar ein keltischer
König, worauf der Name des Berges zurückzuführen ist.
Ob
der Jakobspfad zwischen Hellerplatz und Totenkopf tatsächlich
Bestandteil der berühmten Jakobswege war, ist anzuzweifeln.
Meinen Zweifel mußten jedoch wir alle gleich hinter dem
Johannesbrunnen (südlich Totenkopf) büßen, denn ein
dummer „Verlaufer“ bescherte uns zusätzliche 3 km zu
den 55 km laut Programm. Aber entschädigt wurden wir wieder
durch wunderschöne Pfade: Hohlwege ins Sauermilchtälchen,
Pfädchen am romantischen Triefenbach entlang, Natur pur beim
Überschreiten des Kesselbergrückens.
Die
Gletschermühlen auf dem Kesselberg haben nie einen Gletscher
gesehen, aber diese Felsen sind so schön glatt geschliffen, daß
man ihre Form offenbar bereitwillig der Eiszeit zuschrieb. Die runden
Vertiefungen in den Felsen (Kessel) waren namengebend. Am Kohlplatz
erinnerte uns ein Ritterstein an die Rückzugsgefechte des
Bataillons von Schladen nach der verlorenen Schlacht am Heldenstein
gegen die Franzosen im Revolutionskriegsjahr 1794. Unseren Berg Nr.
3, den Frankenberg, ziert eine gleichnamige Burgruine, von der
allerdings fast kein Gemäuer mehr erhalten ist. Imposant sind
jedoch die erstaunlich glatten Wände der in den Fels gehauenen
Räume und des Halsgrabens.
Obwohl
wir angemeldet waren, geruhten die Wirtsleute der Amicitiahütte
einen Betriebsausflug zu machen. Aber wir konnten uns mit
Mitgebrachtem bestens selbst versorgen. Büßen mußten
wir jedoch ein zweites Mal, denn der sehr steile Kreuzweg von der
Kropsburg nach St. Ottilia nach bereits über 35 km Fußmarsches
erforderte viel Kondition. Aber die Belohnung folgte postwendend:
Wunderschöne schmale Pfade mit viel Heidelbeergrün führten
uns über den Hochberg. Am Schorlestumbe versuchte ich
Wiedergutmachung für den vorerwähnten Umweg mit einer
trockenen Rieslingschorle. Da der Hochberggipfel so flach ist, daß
man ihn gar nicht erkennt, ziert eine von uns noch erhöhte
Steinpyramide die höchste Stelle.
Auf
mehrheitlichen Wunsch legten wir an der PWV-Hütte An den Fichten
nochmals eine Rast ein. Danach genossen wir noch den romantischen
Wolselbachlauf und das Felsenmeer auf dem Hüttenberg (591,2 m),
den ich als „Vorberg“ der Kalmit bei den 5
Bergbesteigungen gar nicht mitgerechnet habe. Nach schönen
Fernblicken von Sühnekreuz und Bergstein kamen wir durch die
zusätzliche Rast verspätet um 21.00 Uhr müde aber mit
unserer Leistung zufrieden am Bahnhof in Neustadt an. Nächstes
Jahr wird’s leichter. Versprochen!
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Samstag, den 25. Mai 2002
54
km-Rundwanderung nördlich von Neustadt
Der
Wetterbericht war einfach zu schlecht. Dennoch kamen noch 8
Teilnehmer zusammen, alle von unserer Sektion. Und wir wurden
belohnt. Es tröpfelte nur ein paar mal; das war nicht der Rede
wert. Und am späten Nachmittag verwöhnte uns sogar noch die
Sonne.
Exotische
Bäume begrüßten uns am Haardtrand. Erwähnen
möchte ich den herrlichen Blick vom Haardter Treppenweg auf die
von Libanon-Zedern umrahmte Hüllsburg. Und noch den weniger
bekannten größten und ältesten Speierling Neustadts
am Kübelweg in der Nähe des Bienenstandes.
Dann
ging’s bergauf, vorbei an den Mauerresten eines ehemaligen
Klosters hinauf zum Bergstein mit schöner Aussicht. Vorbei an
Weinbiet und Hinterem Langenberg erreichten wir die Alte Schanze. Der
dortige Ritterstein erinnerte uns an die Kriegstage im Jahr 1794, wie
dies schon bei unseren Wanderungen in den Jahren zuvor die
Rittersteine am Schänzel (Steigerkopf) und am Kohlplatz taten.
Eine Senke hinauf, um den wenig schönen Weg (blau-weißer
Strich) zu vermeiden, gelangten wir zum Vorderen Stoppelkopf.
Der
Blick vom Hinteren Stoppelkopf ist leider von Bäumen weitgehend
versperrt. Im Zwerlebachtal, dessen Ausgang durch den Kurpfalzpark
versperrt ist, habe ich noch nie einen Wanderer angetroffen. Am
Kaisergärtchen legten wir unsere 2. Rast ein. Von dem lustigen
Namens-Dreiklang Jagdhaus Schaudichnichtum, Forsthaus
Kehrdichannichts und Wachturm Murrmirnichtviel ist leider nicht mehr
viel zu sehen. Vom ersteren stehen nur noch spärliche Reste der
Grundmauern, beim letzteren wurden diese Reste wieder ein wenig
restauriert. Vom Forsthaus Kehrdichannichts, dem ein prunkvolles
Jagd- und Lustschlößchen aus dem Jahr 1722 voranging, ist
deshalb nicht mehr viel zu sehen, weil das Gelände versperrt und
auch der Ritterstein nicht mehr zugänglich ist.
Vorbei
an der Alten Schmelz, durchs Kleine und Große Sommertal kamen
wir zur Ruine Schloßeck. Nach einhelliger Meinung der
Historiker wurde diese Burg aus dem Ende des 12. Jahrhunderts nie
vollendet und damit auch nie bewohnt. Schön anzusehen das von
Prof. Mehlis wiedererrichtete eigentümlicherweise in die
Schildmauer hineingebaute romanische Portal. An der Papierfabrik
Schleipen verließ uns ein Teilnehmer, und das „Häuflein
der 7 Aufrechten“ marschierte weiter zur Hardenburg.
Diese
zu besichtigen hätte zuviel Zeit gekostet, daher ging’s
gleich weiter am Schlangenweiher vorbei ins liebliche Hammelstal und
auf einem wunderschönen schmalen Pfad entlang der Moos-Dell zum
Weißen Stein. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Steines
hat mit weißer Farbe nichts zu tun, sondern mit Grenzweisung.
Bezeichnenderweise steht auf der Karte noch in Klammern
„Streckarsch“. Denn bei den früheren Grenzbegehungen
wurden Knaben gepritscht, d.h. sie wurden über den Stein gelegt
und bekamen vom Pritschmeister leicht den Hintern versohlt, damit sie
sich die Grenze merken sollten.
Im
Oppauer Haus schmeckte einigen von uns das erste Bier des Tages,
andere zogen Kaffee und Kuchen vor. Köstlich, nach fast 40 km
Wanderung! Aber weiter ging’s, vorbei am Vorderen Langenberg,
zum Spielstein, einer fast ebenerdigen Felsplatte mit 3 eingravierten
Sicheln und Würfeln. Vorbei an Stabenberg und Plattenberg
gelangten wir über Gimmeldingen und durch Weinberge zum
Rosengarten und schließlich kurz nach 20 Uhr zum Ausgangspunkt
Bahnhof. Noch schnell ein Gruppenfoto, und die müden Häupter
wandten sich heimwärts.
Ein
Nachwort möge mir gestattet sein. Viele schöne Pfade,
Forst- und markierte Wanderwege nahmen wir unter die Füße.
Einige von mir extra ausgesuchte Wege sind so schön
heidebewachsen, daß nur 2 Fahrspuren den Bewuchs trennen. Aber
leider wurde durch den Holzeinschlag einiges verunziert. Immer
größere Maschinen und Fahrzeuge nehmen immer weniger
Rücksicht auf die Natur und die sich an ihr erfreuenden
Wanderer.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Samstag, den 24. Mai 2003
54
km-Rundwanderung nordwestlich von Neustadt
Wieder
12 Teilnehmer, obwohl einige „alte Hasen“ nicht dabei
waren; dafür kamen 6 neue. Wieder herrliches Wetter; das für
den Nachmittag vorhergesagte Gewitter kam erst in den späten
Abendstunden.
Los
ging’s über den Sonnenweg zur allen bekannten Wolfsburg.
Weniger bekannt dürfte die Sage sein, nach der einstmals ein
dort hausender Raubritter seinen Pferden die Hufeisen verkehrt herum
aufschlagen ließ, um seine Verfolger in die Irre zu führen.
- Nahe Lindenberg unternahmen wir einen kleinen Abstecher zum 1841 zu
Ehren König Ludwig I errichteten Loblochstein.
Von
Lambrecht nach Lambertskreuz führte uns das „Lellebebbelpädel“,
dessen kuriosen Namen zu erklären viel Spaß bereitet. Nach
Fertigstellung dieses Pfades vor dem 1. Weltkrieg meinte der Erbauer
zu seinem körperlich besser als geistig bemittelten Helfer bei
der Suche nach einem Namen: „Ach nennen mern grad nooch dir!“
Von
der Kreuzung Sieben Wege gelangten wir zum Fuß des
Drachenfels-Südfelsens. Ein schmaler Pfad führte uns um die
imposante Felslandschaft der Südwestecke herum, wo es laut
Wanderkarte eine römische Burgfestung gab. Auf dem Westfelsen
genossen wir die herrliche Aussicht bis zum Donnersberg.
Nach
dem Abstieg zum Saupferch ging’s wieder hinauf, vorbei an der
Wüstung Stüterhof, wo die Leininger Grafen einst eine
Pferdezucht betrieben. Im Glastal erinnert ein Ritterstein mit der
Inschrift „Ruinen alte Glashuette und Forsthaus alte
Glashuette“ an die Glasherstellung im 18. Jahrhundert.
In
Weidenthal widerstanden wir erfolgreich den Verlockungen eines
Volksfestes und marschierten zügig weiter zur
Wolfsschluchthütte, wo wir uns allerdings eine Mittagsrast nicht
nehmen ließen. Ein schöner Weg führte uns am
idyllischen Breitenbach entlang nach Breitenstein. Dort nahmen wir
Abschied von 4 Wanderern, die immerhin 37 km geschafft hatten. Es muß
einmal gesagt werden dürfen: Respekt vor denen, die mitmachen,
auch wenn sie nicht sicher sind, die ganze Strecke durchzustehen. Das
ist doch besser als von vornherein zu Hause zu bleiben. Und -
auch 37 km sind eine respektable Leistung!
Auf
dem Drei-Burgen-Rundweg gelangten wir zum ehemaligen Stutgarten der
Burg Spangenberg. Interessant die Einfriedung der Pferdekoppel mit
ursprünglich 215 riesigen bis zu 3 Meter hohen und 1,5 Tonnen
schweren Sandsteinpfosten, von denen etwa noch die Hälfte
vorhanden ist. 7 Stück wurden restauriert, wieder aufgestellt
und mit Holzquerstangen versehen, so dass man sich ein gutes Bild von
der damaligen Einfriedung machen kann.
Von
der Ruine Spangenberg gelangten wir, nicht wie in der Sage über
eine lederne Brücke zur Burg Erfenstein, sondern auf
Wanderpfaden hinunter zum Ort Erfenstein und wieder hinauf zur
Hellerhütte. Da wir gut in der Zeit lagen, genehmigten wir uns
eine längere Pause, die mit einigen „kreisenden Schoppen“
(der Hitze entsprechend nur Schorle) verschönert wurde.
Natürlich
fiel es schwer, die müden Glieder für die letzten 10 km zu
erheben. Aber an dem Grenzfelsen Breite Loog gab es bereits wieder
eine kleine Pause, um den freigelegten und restaurierten Dreimärker
zu betrachten. Er könnte viel erzählen, so z.B. von den
blutigen Streitigkeiten bei der Grenzbegehung im Jahre 1748, die mit
einem Toten und etwa 20 Verletzten endeten. Damit der Felsen sauber
gehalten werden kann, hat die Ortsgruppe Lambrecht des
Pfälzerwald-Vereins einen Besen aufgehängt. Dazu gibt es -
nein, kein Gipfelbuch, aber ein Besenbuch - ein wirklich humorvoller
Einfall.
Nächste
Station: Kaisergarten. Hier feierten die Lambrechter u.a. 1804 ein
befohlenes Fest anlässlich der Kaiserkrönung Napoleon I.
Daher der Name Kaisergarten. - Vorbei an der Hauberanlage, wo der
Neustadter Ehrenbürger Ludwig Heinrich Hauber seiner Frau
Karoline ein Denkmal gesetzt hat, erreichten wir um halb neun den
Neustadter Bahnhof.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Samstag, den 15. Mai 2004
62
km-Rundwanderung
Eine
Wanderung der Superlative! Bestes Wanderwetter, Sonnenschein, aber
nicht heiß. Kein Ausfall, alle 10 Teilnehmer erreichten sogar
früher als geplant wieder den Ausgangspunkt Bahnhof. Die
Rucksackapotheke wurde nicht gebraucht. Mit 62 km die längste
Tour, und mit 55,9 Jahren der höchste Altersdurchschnitt der
Teilnehmer seit 1999, seit ich die Ehre habe, die
Tagesweitwanderungen zu führen. Aber leider war erstmals keine
Frau dabei. Zwei Nicht-DAV-Mitglieder wurden durch die Zeitung
informiert. Den Pressewart wird's freuen. Auch ein Mitglied der
Sektion Ludwigshafen nahm teil.
Zahlreiche
idyllische Bäche waren über große Strecken unsere
Begleiter: der Bach im Heidenbrunnertal, die Bäche Argenbach,
Speyerbach, Erlenbach, der Bach, der vom Locheck herunterkommt, dann
Miedersbach, Helmbach, Kohlbach, der Bach, der uns ins Birkental
führte, und schließlich noch die Bäche im Finstertal
und Kaltenbrunner Tal. Viel Natur pur war zu schauen, wobei das
Plätschern, Murmeln und Gurgeln der Bäche in unseren Ohren
klang. Viele Bäche sind aufgrund der bis Anfang des 20. Jhdts.
betriebenen Flößerei in Sandsteinmauern gefasst. Die
Stauwerke und Stauseen (Wooge oder Klausen genannt) sind ebenfalls
Relikte aus jener Zeit. Selbst der kleine Erlenbach, dessen
Sumpfdotterblumen in voller Blüte standen, diente der Flößerei.
Aber auch viele natürliche Bachläufe erfreuten unser Auge.
Besonders der Miedersbach hat sich im Wiesen- und Moosgelände in
vielen Windungen seinen Weg gesucht, wobei sich Inselchen und kleine
Moore gebildet haben. Ein lieblicher Anblick!
Am
Gedenkstein für den Pfälzerwäldler Ludwig Fischer
unweit vor der Hellerhütte hielten wir kurz inne. - Die fast
allen Teilnehmern noch nicht bekannte Erdspalte in der Nähe des
Studerbildes ist keine Aufsehen erregende Sehenswürdigkeit. Nur
einige Meter tief und etwa 40 cm breit. Aber es war interessant zu
lauschen, wie ein hinabgeworfener Stein einige Sekunden lang
weiterkullerte, so dass man davon ausgehen kann, dass sich diese
Spalte noch im Berg fortsetzt.
Einen
Ritterstein am Wege möchte ich erwähnen: "Hecker-Brücke".
Unter Anführung eines beherzten Appenthaler Bürgers, der
nach dem badischen Freischärler Friedrich Hecker aus dem
Revolutionsjahr 1848 den Beinamen Hecker erhielt, wurde der Bau
dieser Brücke durch eine "Revolution" der Bürger
ertrotzt. - Eine Schmunzel-Story ist auch aus Appenthal überliefert:
Ludwig I. von Bayern besuchte mit seiner Mätresse Lola Montez
dort einen Freund. Einem sittenstrengen hohen geistlichen
Würdenträger soll der König geantwortet haben:
"Bleiben Sie bei Ihrer Stola, ich bleib bei meiner Lola".
In
Speyerbrunn legten wir auf den zur Quelle des Speyerbaches
hinabführenden Steintreppen eine wohlverdiente Mittagsrast ein.
- Lange schon bevor wir den Helmbachweiher erreichten, versprach ich
eine Rast am dortigen Kiosk und an der Totenkopfhütte. Leider
war der Kiosk geschlossen. Aber von freundlichen Ausflüglern,
die gerade Spieße grillten, bekamen wir eine schmackhafte
Kostprobe. Laut Zeitplan mussten wir die Totenkopfhütte um 18.20
Uhr erreichen. Ich fürchtete, gesteinigt zu werden, sollte auch
sie geschlossen sein. Der "Speedy-Trupp" eilte voraus und
konnte die Wirtsleute gerade noch rechtzeitig am Abschließen
der Hütte hindern. Es war für alle eine Ehrensache, das
freundliche Angebot der PWV'ler, im Auto mitfahren zu dürfen,
abzulehnen. Aber die Mehrheit wollte nicht nochmals von einer Rast
die müden Glieder erheben müssen, so dass wir der
Kaltenbrunner-Hütte die kalte Schulter zeigten und zum Bahnhof
durchmarschierten.
Noch
schnell ein Gruppenfoto, und die meisten versprachen, das nächste
Mal wieder dabei zu sein.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Samstag, den 21. Mai 2005
52
km-Rundwanderung
18
Teilnehmer - Rekord! Und das trotz der schlechten Wettervorhersage.
Aber wir hatten riesiges Glück. Regenschutz brauchten wir erst
gegen Schluss am Weinbiet. Allerdings war es unangenehm schwül.
Durch eine Streckenverkürzung kamen statt 54 "nur" 52
km zusammen. Aber 52 km,. die es in sich hatten, denn der Höhenmesser
addierte knapp 2.000 Meter Höhendifferenz. Es ging ständig
bergauf und -ab.
Eine
Teilnehmerin wollte sowieso nur eine Teilstrecke laufen. Die
verbliebenen 17 hielten alle bravourös durch, davon 11 DAV'ler
aus unserer Sektion: Margarete Kilgus - die Henne im Korb -, Thomas
Böhmer, Ottmar Hery, Klaus Koppenhöfer, Robert Nabinger,
Rainer Nett, Thomas Oppenheimer, Herbert Schmitt, Peter Seckinger,
Winfried Stöckl und meine Wenigkeit. Erwähnen möchte
ich noch meinen 13-jährigen Enkel, nicht nur weil der Opa stolz
auf ihn ist, sondern weil ich hoffe, dass er die Jugend motivieren
kann. Also ihr Jungen, mitgemacht das nächste Mal! Weitwandern
stärkt die Kondition fürs Hochgebirge!
Nach
Überqueren von Stabenberg und Eckkopf bot sich unseren Augen der
imposante Tiefblick vom oberen Rand des Südbruchs des
stillgelegten Forster Basaltsteinbruchs hinunter auf den "Kratersee".
Eigentlich ist das Gelände abgesperrt, doch der Zaun ist
lückenhaft. Aber Nachahmer, aufgepasst! Nicht zu nah an den Rand
treten, er könnte abbrechen.
Hinunter
ins Wachenheimer Tal, hinauf zum Hexenstein und das Poppental
querend, erreichten wir Seebach. Die Sandsteintafeln im Lapidarium
des bereits 1136 erstmals erwähnten ehemaligen
Benediktinerinnenklosters St. Laurentius berichten ohne Angabe der
Gründe von einer Zerstörung im Jahre 1472. Bei meinen
Recherchen stieß ich auf den Kurfürsten Friedrich I., der
aufgrund einer von vielen Fehden 1471 bei einer Belagerung des
leiningischen Bad Dürkheims sein Feldlager im Kloster aufschlug.
Dabei wurde das Langhaus der Kirche so sehr beschädigt, dass es
renoviert werden musste. Der aus einem Faltblättchen über
die nunmehr protestantische Kirche zitierte Satz "Während
der Belagerungszeit lockert sich die strenge Zucht im Nonnenkloster"
verfehlte seine erheiternde Wirkung nicht.
Der
römische Steinbruch Kriemhildenstuhl aus dem 2. bis 3.
Jhdt.n.Chr. weist viele Inschriften und Steinmetzzeichen der in Mainz
stationiert gewesenen 22. Legion aus. Bei den Nazis fiel der
pfälzische Archäologe Friedrich Sprater in Ungnade, da er
keine keltisch-germanische Kultstätte, sondern zweifelsfrei nur
einen römischen Steinbruch erkennen konnte.
Nächster
Höhepunkt: der Heidenmauer genannte keltische Ringwall in Form
eines gespannten Bogens aus der Zeit um 500 bis 400 v.Chr. Dort gibt
es zwei aktuelle Ausgrabungsstätten: Eine vom Haupttor im Osten
und eine direkt oberhalb des Kriemhildenstuhls, wo man laut Aussage
des Grabungsleiters außer Mauern noch keine Gegenstände
gefunden hat, da die Latenezeit (550 - 10 v.Chr.) offenbar tiefer
liege.
Vorbei
an der Kaiser-Wilhelm-Höhe wanderten wir ein Stück am
Ringwall entlang und konnten uns so die gewaltigen Dimensionen des
damals bis zu 11 m hohen Walls gut vorstellen. Nach Aufsuchen eines
keltischen Hügelgrabes und kurzem Halt amTeufelsstein, einem
angeblich germanischen Kultplatz, gönnten wir uns eine
ausgedehnte Halbzeitrast an der PWV-Hütte an der Weilach.
Hinauf
und hinunter ging's weiter immer munter: Peterskopf mit Bismarckturm,
Isenachtal, Hardenburg, Dicke Eiche, Hammelstal, Weißer Stein,
Rotsteig, Silbertal. Im dortigen Forsthaus zischten die ersten Biere
des Tages vor dem direkten Anstieg zum Weinbiet. An der Terrasse Dr.
Welsch empfing uns der Rheinpfalz-Pressefotograf, der unseren müden
Mienen ein Lächeln abzwang. Spät, Viertel vor neun,
erreichten wir glücklich den Bahnhof.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Samstag, den 20. Mai 200654
km-Rundwanderung
Erstmals
in 8 Jahren kein Wetterglück. Und dennoch neuer Rekord: 21
Teilnehmer; einer ging nur eine Teilstrecke mit, ein zweiter musste
wegen angeschlagener Gesundheit aufgeben, 19 kamen wohlbehalten ins
Ziel, darunter 3 Power-Frauen. 4 Teilnehmer hatten wir der
bevorstehenden Mâcon-Wanderung zu verdanken. Abgesehen von
meinem 14-jährigen Enkel war der jüngste Teilnehmer 37
Jahre alt, bei einem Altersdurchschnitt von 50 Jahren. Wo bleibt die
Jugend?
Auf
dem Heidelberg bei Hambach, den wir überschritten, sind noch
Ringwälle aus dem Spanischen Erbfolgekrieg erhalten. Hierzu sei
kurz bemerkt: Der letzte spanische Habsburger, Karl II, ein
infantiler Krüppel, der 1700 starb, hatte in seinem Testament
Philipp von Anjou auf Betreiben Ludwigs XIV als Gesamterben
eingesetzt. Das widersprach der englischen Gleichgewichts- und der
habsburgischen Machterhaltungspolitik. Wegen des absehbaren Krieges
wurde auf deutscher Seite schon vor seinem Beginn 1701 eine
Verteidigungslinie aufgebaut. Der nicht umkämpfte
vorderpfälzische Teil dieser Linie nördlich der
französischen (!) Festung Landau reichte vom Heidelberg über
Speyerdorf und entlang des Speyerbaches bis Speyer. Man wollte damit
eine nochmalige Verwüstung der Pfalz wie im erst 1697 beendeten
Pfälzischen Erbfolgekrieg vermeiden.
Auf
dem nächsten Heidelberg sahen wir noch alte
Grundstücks-Parzellen, die vom früheren Obstanbau
herrühren, mit dem sich die damals recht armen St. Martiner
Winzer ein Zubrot verdienen konnten. Ein winziges Stück
Steinwall soll der Rest eines keltischen Ringwalles sein. Auf seinem
Freizeitgelände hat ein St. Martiner Bürger phantasievoll
die "Ruine Heidelberg" geschaffen.
Kalt
war's. Wir froren während der kurzen Rast im zugigen Vorbau der
St. Anna-Hütte, die wir über Werderberg, Villa Ludwigshöhe
und Schweizer Haus erreichten. Der steile Aufstieg zu den
Teufelsfelsen konnte uns ein wenig erwärmen, aber dann kam zur
Kälte noch der Regen hinzu. Vorbei am Waldhaus Drei Buchen, die
Ruine Meistersel auslassend, strebten wir durchnässt dem
Lambrechter Naturfreundehaus zu. Eine warme Suppe war das Beste, um
die Lebensgeister wieder zu wecken.
Beim
Verlassen des Hauses "schüttete es aus allen Rohren".
Wir beschlossen daher mehrheitlich, ab Helmbach den kürzesten
Weg nach Hause zu gehen. Doch, welch Wunder, in Helmbach schien
plötzlich die Sonne. Der "Ausrede" beraubt, kamen wir
nicht umhin, die vorgegebene Route einzuhalten. Über die
Wolfsgrube bei Schwabenbach, die Wolfsschluchthütte rechts
liegen lassend, erreichten wir Esthal, und uns erreichte das
Unwetter. Auf die beiden Burgruinen Erfenstein verzichtend, eilten
wir das Erfensteiner Tal hinab. Wir hatten Glück, in diesem Tal
gab es keinen Windbruch. Der letzte Aufstieg, rund 300 Höhenmeter
zur Hellerhütte im stömenden Regen, war nochmals ein hartes
Stück Arbeit. Welch Glück, die Hütte war gegen 19.00
Uhr noch nicht geschlossen. Ein Blick auf meinen Höhenmeter
verriet: 2000 Höhenmeter im Anstieg hatten wir bewältigt.
Und das bei diesem Wetter!
Und
dann kam als versöhnender Abschluss nochmals die Sonne hervor.
Bezaubernd anzuschauen, wie die sanften Strahlen der untergehenden
Sonne den dampfenden Wald durchfluteten. Spät erreichten wir den
Bahnhof kurz nach 21.00 Uhr.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Berichte über die von mir geführten
Monatswanderungen
Fotos im Bild großklicken (außer einigen Schildern)
Rundwanderung am 23. April 2017
Route:
Neustadt Hbf - Häuselberg - Heidelberg - Schlössel Geispitz -
Hambacher Schloß - Diedesfelder Wetterkreuz - Hohe
Loog-Hütte - Grünes Bänk'l - Neustadt Hbf
Kartenmaterial:
Neue Kartenserie "Naturpark Pfälzerwald" Maßstab 1:25.000
Oberhaardt von Neustadt/Wstr. bis zum Queichtal (Blatt NP6), 2. Aufl., 2010
-offizielle topografische Wanderkarten von PWV und LVermGeo-
Karte erhältlich in Buchhandlungen, PWV-Hütten oder bei der PWV-Geschäftsstelle in 67433 Neustadt, Fröbelstraße 24
Achtung: Die Kartenserie wird nicht mehr neu aufgelegt, wenn sie vergriffen ist.
Pietruska Rad-, Wander- und Freizeitkarte, Maßstab 1:25 000
Edenkoben, Landau & Neustadt, 2. Auflage 2013
Literatur: Paul
Habermehl, Tore, Türme und Kanonen - Neustadt und seine
Befestigungsanlagen, 2010, ISBN: 978-3-00-033162-6 (maßgebendes
Kapitel: Neustadt im Spanischen Erbfolgekrieg 1701 -1714)
Punkt 9 Uhr starteten
wir unsere Wanderung mit nur 6 Teilnehmern. Einige stießen
später noch hinzu, sodass letztendlich doch noch 13
Wanderer zusammenkamen. Unser erstes Ziel war der kaum bekannte
Häuselberg, ein unter Naturschutz stehendes Wäldchen, das wir
an seiner Nordseite über Privateigentum vom Römerweg aus
erreichten. Wie erwartet, begegneten wir hier keinem Menschen. Den
Südteil des Wäldchens, der mir als Klosterwald bekannt ist,
durchziehen einige schön hergerichtete und auch mit Stufen
versehene Pfade. Im 2. Weltkrieg wurden am Südwestende einige
Plätze für Flakstellungen geschaffen. Einen solchen
betrachteten wir, bevor wir wiederum über Privatgelände nach
Süden zur Enggasse abstiegen. Dank der Genehmigungen der
Privateigentümer ersparten wir uns Umwege mit Asphalttreterei.
Auch gehe ich davon aus, dass vor der Bebauung direkte öffentliche
Zugänge von Nord und Süd vorhanden waren. Somit kamen wir
alten Wegspuren etwas näher. Auch bestand mit Sicherheit ein
direkter Zugang vom ehemaligen Liebfrauenpfründhaus in der
Enggasse 20 aus. Die Klosterstraße stößt direkt auf
diesen Gebäudekomplex, der heute aus Eigentumswohnungen besteht.
Ein Schild verrät, dass es sich um die Mitte des 14. Jh.
errichteten Frühmesserei "Unserer lieben Frau" mit Pfründhaus
handelt. Der Frühmesser
war laut Wikipedia ein katholischer Priester, der als Inhaber von aus
Stiftungerträgen finanzierten Pfründen regelmäßig
die Frühmesse vor Arbeitsbeginn der Bevölkerung zu
zelebrieren hatte. Dass es hier ein Kloster gab, steht weder auf dem
Schild, noch konnte ich es trotz vieler Recherchen herausfinden. Aber
es gibt die Klosterstraße und den Klosterbrunnen vor dem
Haus Nr. 4. Ich versuche weiterhin zu recherchieren.
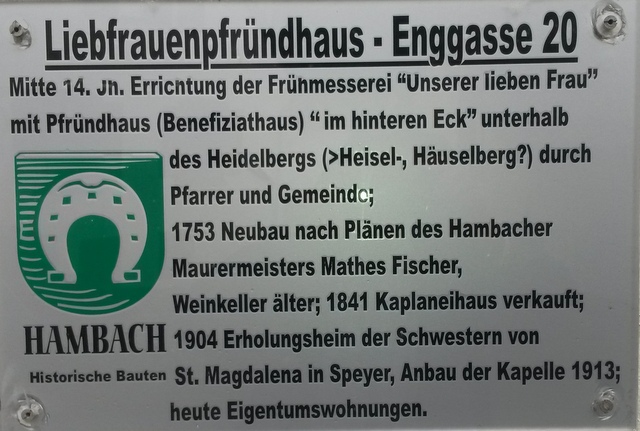 |

Das Pfründhaus - Foto: Uwe Rinka
|
Wir wanderten weiter über den Kirchbergweg bis zu der Stelle, wo
die Holzgasse heraufführt. Genau dort wurde 1701 eine Schanze
errichtet, die zu dem Befestigungswall aus dem Spanischen Erbfolgekrieg (1701 - 1714) gegen französische Angriffe
gehörte, der von Speyer kommend am Speyerbach entlang bis
Speyerdorf und weiter über die Guttingsche Mühle, parallel
zum Horstweg, entlang der Weinstraße und den Holzweg hoch zum
Kirchbergweg führte. Dort verzweigte sich der Wall und verlief den
steilen Hang zu dem länglichen in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Heidelberg hinauf. Letzterer wurde ringsherum mit
einem
Wall und Batteriestellungen befestigt. Unten am Kirchbergweg ist
aufgrund der Errichtung von Trockenmauern für den
Weinbau davon nichts mehr zu sehen. Aber auf der Südhälfte des Heidelberges gibt
es noch nennenswerte Reste, die wir uns anschauten. Dazu stiegen wir
die Holzgasse hoch. Nach einem Links-Rechts-Abzweig geht es
geradeaus hoch, zunächst auf eindeutigem Weg. Dann muss man weglos
auf teils rutschigem Boden hinaufsteigen. An oder bei der gut
erkennbaren Saukuhle stößt man auf die Ringbefestigung. Wir
gingen ein paar Schritte links, also auf der Ostseite des Heidelberges
in südlicher Richtung, und
entdeckten einen der beiden Zweige
des den Hang heraufführenden Walles, der eigentlich ein Doppelwall
ist. Noch deutlich zu sehen sind zwei dicht nebeneinander parallel
verlaufende Erdwälle mit einem Graben dazwischen. Siehe Foto unten
links. In natura sind die Wälle deutlicher zu erkennen als auf den
Fotos. Aber in der Vergrößerung müsste es deutlich
genug sein. Diese Karte zeigt die Befestigungslinie von Speyerdorf bis zum Heidelberg.
Wir machten eine kleine Pause, in der ich die Entstehungsgeschichte erläuterte. Der letzte spanische Habsburger, Karl II, ein
infantiler kinderloser Krüppel, hatte in seinem Testament
auf Betreiben Ludwigs XIV dessen Enkel Philipp
von Anjou als Gesamterben
eingesetzt. Das widersprach der englischen Gleichgewichts- und der
habsburgischen Machterhaltungspolitik. Wegen des schon vor dem Tod des
Königs im Jahre 1700 absehbaren Krieges
wurde auf deutscher Seite 1701 eine
Verteidigungslinie aufgebaut, deren vorderpfälzischer Teil,
wie oben beschrieben, von Speyer zum Heidelberg führte. Man wollte damit
eine nochmalige Verwüstung der Pfalz wie im erst 1697 beendeten
Pfälzischen Erbfolgekrieg vermeiden. Man
beachte, dass Landau damals zu Frankreich gehörte. Es
wurde 1702 von kaiserlichen Truppen unter dem Oberbefehl des
Markgrafen Ludwig von Baden erobert. Er wurde Türkenlouis genannt,
da er an den siegreichen Kriegen gegen die Türken
maßgeblichen Anteil hatte. Man muss bedenken, dass das
Kaiserreich durch den Großen Türkischen Krieg, der erst 1699
endete, sehr geschwächt war. - Ich merkte noch an, dass der
Erzherzog Joseph, Sohn des Kaisers Leopold I, zur Übernahme des
offiziellen Oberbefehls mit seinem gesamten Hofstaat in 77 Kutschen
anreiste. Die Kutschen neuartigen Typs wurden Landauer genannt,
über deren Namensherkunft es verschiedene Versionen gibt. Eine
davon ergibt sich aus dieser Reise. - 1703 eroberten die Franzosen Landau
zurück. Während der Belagerungszeit überrannten sie den
Befestigungswall südlich von Neustadt und nahmen die Stadt ein. Siehe auch Wikipedia: Spanischer Erbfolgekrieg.
Links: Reste des vom Kirchbergweg heraufführenden Walls - rechts: Die Ostseite des Walls auf dem Heidelberg
Nur ein paar Schritte weiter steht unterhalb des Walles das 1717 von
Hambacher Winzern errichtete Wetterkreuz, das Unwetter abwehren sollte.
Die auf seinen Balken verteilten Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben
des Benediktussegens. Ein mir unbekannter Autor hat das Wetterkreuz wie folgt beschrieben: Seite 1 Seite 2. Siehe auch Wikipedia.
Wir gingen auf der oberen Kante des noch deutlich ausgeprägten Walles
weiter Richtung Süden (Foto oben rechts) bis zur Südspitze
mit einer
Bank über einem Steinbruch. Von dort hat man einen wunderbaren
Blick auf das Hambacher Schloß. Nun wandten wir uns auf der
Westseite nach Norden. Wir gingen jetzt nicht mehr direkt auf der
Oberkante, sondern ließen den Wall etwas weiter links liegen. Da
der mittlere Teil des Walles etwas zurückgenommen und somit
eingebuchtet ist, querten wir nun den Wall an der Stelle, wo er nach
rechts schwenkt. Nach wenigen Metern schwenkt er wieder nach links, was
auf dem Foto unten rechts festgehalten ist. Dann stiegen wir nach
links auf einem steilen Trampelpfad ab, um schließlich in der
Schloßstraße die Ruine Schlössel Geispitz zu
erreichen, von der hauptsächlich noch die hohe Stützmauer
erhalten ist. Geispitz, das Hambacher Schloß und die Stadt
Neustadt waren Teil dieser letztendlich nutzlosen
Befestigungsstrategie.
Links: Das Hambacher
Schloß vom Süden des Heidelberges aus gesehen (Foto:
Uwe Rinka) - rechts: Westteil des Walles auf Höhe der Einbuchtung.
Links: Das Wetterkreuz
auf dem Heidelberg - Mitte: Das Diedesfelder Wetterkreuz (beide Fotos:
Uwe Rinka) - rechts: Tafel an der Mauer der Ruine
Über Freiheits-
und Handwerkerpfad erreichten wir den Parkplatz des Hambacher
Schlosses. Der Forstweg Richtung Klausental brachte uns bis kurz vors
Zeter Berghaus. Da nahmen wir rechts den steilen Weg aufwärts, um
zu dem linkerhand stehenden Diedesfelder Wetterkreuz zu gelangen.
Dieses sollte denselben Zweck erfüllen wie das Kreuz über
Hambach, nämlich böse Wetter abwehren. Von hier hat man
einen schönen Blick über die Rheinebene. Ein uriger schmaler
Pfad führte uns hinüber zum Sommerbergweg, auf dem wir bis
zum Bildbaum aufstiegen. Das kleine Stück zur Hohe Loog-Hütte
schafften wir auch noch, um unser verdientes Mittagessen
einzunehmen.
Links: Die fast vollständige Gruppe auf der Hohen Loog - rechts: Heimwärts (Fotos: Uwe Rinka)
Gut ausgeruht stiegen wir dann ab nach Neustadt, aber nicht wie
vorgesehen über die allseits bekannte Kühungerquelle. Wir
gingen stattdessen ein Stück Richtung Speierheld, um links
wiederum auf einem schönen Pfad den Pfad mit dieser
Markierung  zu erreichen. Das grüne Bänk'l passierten wir ohne Platz
zu nehmen. Wir erreichten den Römerweg, den wir gleich wieder
Richtung Afrikaviertel verließen, um nach wenigen Metern links
auf einen letzten schönen Pfad durch die ehemaligen Parkanlagen am
Nollen zu gelangen. Durch die Hauberallee und die Hauberanlagen
wanderten wir sodann zum Bahnhof.
zu erreichen. Das grüne Bänk'l passierten wir ohne Platz
zu nehmen. Wir erreichten den Römerweg, den wir gleich wieder
Richtung Afrikaviertel verließen, um nach wenigen Metern links
auf einen letzten schönen Pfad durch die ehemaligen Parkanlagen am
Nollen zu gelangen. Durch die Hauberallee und die Hauberanlagen
wanderten wir sodann zum Bahnhof.
Bei dieser Tour ließ es sich leider nicht vermeiden, einige
Strecken auf Asphalt zurücklegen zu müssen. Dafür
entschädigten uns aber die größtenteils
wunderschönen schmalen Waldpfade.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Rundwanderung am 7. Mai 2017
(Fotos von Uwe Rinka, bis auf die beiden letzten)
Route: Erfenstein - Ruine
Spangenberg - Steinbruch - Stutgarten - Ruine Breitenstein -
Wolfsschluchthütte - Wassersteine - Ruine Erfenstein - Erfenstein
Kartenmaterial:
Neue Kartenserie "Naturpark Pfälzerwald" Maßstab 1:25.000
Oberhaardt von Neustadt/Wstr. bis zum Queichtal (Blatt NP6), 2. Aufl., 2010
-offizielle topografische Wanderkarten von PWV und LVermGeo-
Karte erhältlich in Buchhandlungen, PWV-Hütten oder bei der PWV-Geschäftsstelle in 67433 Neustadt, Fröbelstraße 24
Achtung: Die Kartenserie wird nicht mehr neu aufgelegt, wenn sie vergriffen ist.
Pietruska Rad-, Wander- und Freizeitkarte, Maßstab 1:25 000
Edenkoben, Landau & Neustadt, 2. Auflage 2013
Literatur: 2 Broschüren des Vereins Burg Spangenberg, je 2,50 €, auf der Burg erhältlich:
Burg Spangenberg und der 3-Burgen-Rundweg
Der Stutgarten bei Burg Spangenberg im Elmsteiner Tal
Walter Eitelmann, Rittersteine im Pfälzerwald, 5. Auflage.
Pfälzerwald-Verein Neustadt an der Weinstraße, ISBN
3-00-003544-3
Sicherlich
spielte die Schlechtwetter-Vorhersage eine Rolle, dass wir nur 6
Teilnehmer waren. Dabei war das Wetter gar nicht so schlecht. Den
ganzen Vormittag kein einziger Tropfen Regen. Nachmittags zeitweise
ganz leichter Nieselregen.
Um 9:05 Uhr nach der Busfahrt starteten wir in Erfenstein am Parkplatz
vor dem Bahnhof, um als erstes den Aufstieg zur Ruine Spangenberg unter
die Füße zu nehmen. Durch einen Torbogen betraten wir den
Weg zur Burg. Gleich am Anfang zur Linken, leider etwas versteckt,
klärt uns ein Schild über den "Burgfrieden" bei dieser Ruine
auf: "Burgfrieden - Gelände um eine Burg mit besonderen,
verbrieften Hoheitsrechten. Als Grenzen wurden Naturgegebenheiten
gewählt. Grenzverlauf bei Burg Spangenberg: Speyerbach -
Höllischtal - Schloßtal - Alter Weinweg - Otterfels.
Fläche = 0,67 qkm."
Auf eine detaillierte Burgbeschreibung möchte ich verzichten, da
die Seiten der von mir angegebenen Links ausführlich informieren.
Der Verein Burg Spangenberg e.V. kümmert sich nicht nur um diese
Burgruine, sondern auch um den Stutgarten und den
3-Burgen-Rundweg, und hat außer dem oben erwähnten Schild
auch noch eine Reihe anderer Schilder mit interessanten Informationen
aufgehängt. Er veranstaltet Führungen auf der Spangenberg und
betreibt in der Unterburg ein Restaurant, um seine Finanzen
aufzubessern, aber natürlich auch um dem Wanderer eine Einkehr in
der urigen Lokalität zu bieten. Die Webseite des Vereins informiert ausführlich über die Burg, den Steinbruch, den Stutgarten und den 3-Burgen-Rundweg.
Auf
dem Weg unter der Burg klärt ein Schild darüber auf, dass
Klettern verboten ist. Wir erfuhren, dass 2 Wanderfalken-Paare und ein
Kolkraben-Paar brüten. Auch darf die Oberburg daher nicht betreten
werden. Ein Stückchen weiter sahen wir die Burg mit ihren 3 Teilen
Oberburg, Mittelburg und Unterburg vor und über uns liegen.
Schön zu sehen die beiden schmalen und dennoch imposanten
Schildmauern der älteren Oberburg und der später erbauten
Mittelburg. Das Restaurant in der Unterburg war noch geschlossen. Sehr
empfehlenswert ist eine Burgführung nach dem 30. Juni, wenn die
Vogel-Brutzeit zu Ende ist. Anmeldung in der Burgschänke.
Oben links: Ruine
Spangenberg von unten betrachtet - Mitte: Die Schildmauern der Burg
(Blick von oberhalb) - rechts: Schild am Eingang zur Unterburg
Nun ging's aufwärts zum Steinbruch. Auf halber Höhe zweigt
der 3-Burgen-Wanderweg (Zeichen: Stilisierter Burgturm mit Zinnen  ) zum Burgbrunnen ab, den wir rechts liegen
ließen, um ohne Markierung weiter aufzusteigen. Ein ebener
Forstweg biegt links ab zum Steinbruch. Hierbei handelt es sich
nicht um einen Steinbruch im üblichen Sinne, sondern um die Stelle
auf dem Grat des Schlossberges, wo noch Pfostenrohlinge liegen
geblieben sind. Die Pfosten wurden also aus den vielen herumliegenden
Felsplatten gewonnen. Sie dienten der Einfriedung des Stutgartens.
) zum Burgbrunnen ab, den wir rechts liegen
ließen, um ohne Markierung weiter aufzusteigen. Ein ebener
Forstweg biegt links ab zum Steinbruch. Hierbei handelt es sich
nicht um einen Steinbruch im üblichen Sinne, sondern um die Stelle
auf dem Grat des Schlossberges, wo noch Pfostenrohlinge liegen
geblieben sind. Die Pfosten wurden also aus den vielen herumliegenden
Felsplatten gewonnen. Sie dienten der Einfriedung des Stutgartens.
Wir gingen den ebenen Weg zurück und bogen rechts ab Richtung
Burg, um aber gleich links zum Burgbrunnen abzuzweigen und um wieder
auf den 3-Burgen-Rundweg zu gelangen.
 |
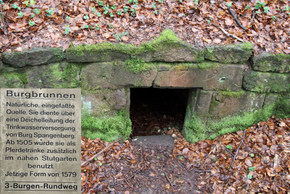 |
Oben links: Steinbruch - rechts: Burgbrunnen
Weitere Info über
den Burgbrunnen aus: Der Spangenberger - Mitteilungsblatt des Vereins
Burg Spangenberg e.V. - Nr. 17, Juli 1993 Seite 1 Seite 2
Oben links: Blick in den Brunnenschacht - rechts: restauriertes Stück der Stutgarten-Einfriedung
Den obigen Blick in den Brunnenschacht ermöglichte der starke
Blitz der Kamera. Schön zu sehen ist der Knick nach links der
hinteren Brunnenkammer.
Der Weg führte uns
sodann weiter am oberen Rand des Stugartens entlang. Verstreut im
Gelände zur Rechten erblickt man vereinzelte Bruchstücke der ehemaligen
Pfosten. Etwas weiter befindet sich die Stelle mit einem Stück restaurierter Einfriedung.
Nun
folgten wir dem 3-Burgen-Rundweg, der uns hinunter zur L 499
führte. Hier muss man sich links halten, vorbei am Parkplatz
Breitenstein, von dem aus der Wanderweg zur Wolfschluchthütte
führt. Auch vorbei an dem zum Wanderweg parallel verlaufenden
Fostweg bis zu dem hoch führenden geschotterten Forstweg. Am
Anfang
dieses Weges stößt man auf den
Ritterstein Nr. 113: R. Breitenstein 500 Schr. Einige Meter muss man
mit dem Schotter vorlieb nehmen, dann führt ein schöner Pfad
links ab zur Burg. An einer Linkskurve steht ein Dreikantsein, also ein
Grenzstein am Zusammentreffen von 3 Territorien. Die Tafel am Baum gibt
Auskunft.
Die Burg ist mehrfach
geteilt in Ältere obere Burg, Mittlere Burg und Nieder-Breitenstein.
Aber letztere ist nochmals dreigeteilt in Oberburg, Nördliche Unterburg
und Südliche Unterburg. Ganz schön kompliziert. Zum besseren
Verständnis bei der Besichtigung habe ich Zeichnungen vom Grundriss
verteilt. Eine ausführliche Beschreibung mit diesem Grundriss enthält
diese Seite
Oben links: 4 Fotos vom Dreikantstein: Tafel und alle 3 Seiten des Steins - rechts: Nieder-Breitenstein
Auf
dem Foto oben rechts sieht man den Felsen von Nieder-Breitenstein, auf
dem die Reste der Oberburg stehen, und den Torbogen mit Mauerresten, der zur
Südlichen Unterburg gehörte. Etwa in der oberen Mitte ist
eine Steintreppe mit dem Rest einer schützenden Mauer zu erkennen,
die in der Fortsetzung als Holztreppe ins Innere des Torbaus der
Südlichen Unterburg geführt haben musste.
Das Foto unten links gewährt einen Einblick in den Brunnen oder
die Zisterne, der oder die sich unterhalb der Schildmauer von
Nieder-Breitenstein befindet. Um herauszufinden, um was es sich
tatsächlich handelt, müsste man ausgraben. Schade, dass
dafür das Geld fehlt.
Oben links: Brunnen oder Zisterne - rechts: Im
Vordergrund die Mittlere Burg, dahinter die Schildmauer der Oberburg von
Nieder-Breitenstein
Wir
besichtigten die gesamte Burganlage, wobei wir ganz schön steil
bis zur Oberen Burg aufsteigen mussten. Dann kehrten wir zum Parkplatz
zurück und nahmen den am schönen einstigen Floßbach
entlang führenden Wanderweg unter die Füße. Zwischen
Weg und Bach wurde schwer abgeholzt, aber man hat an mehreren Stellen
Äste und Gestrüpp über dem Bach aufgehäuft,
sicherlich um ein Refugium für verschiedenste Tierarten zu
schaffen. Um 13:00 Uhr erreichten wir, wie vorgesehen, die
Wolfsschluchthütte, um unsere, denke ich, wohlverdiente
Mittagspause zu genießen.
Links: Die Wandergruppe vor der
Wolfsschluchthütte - rechts: Selbstporträt unses Fotografen Uwe. Bei dieser Gelegenheit ihm ein herzliches Dankeschön
Links: Am größten Wasserstein - rechts: Der Bergfried der Burgruine Erfenstein (von Spangenberg aus herangezoomt)
Nach dem obligatorischen Gruppenfoto ging's ein kleines Stück
Richtung Esthal weiter. Dann bogen wir rechts auf den hoch
führenden Wanderpfad Nr. 7 ab bis kurz vor Esthal. Am Bildstock
zur Rechten schwenkten wir nach rechts auf den Weg mit den
Markierungszahlen 8 und 9 zu unserem
nächsten Ziel, den Wassersteinen. Achtung, man kann leicht den Weg
verfehlen.
Zunächst erreichten wir den Weg mit den Markierungen  und
und  und dem Schild mit der forstwirtschaftlichen Zwecken dienenden Nummer
64. Etwas später taucht auch die Nr. 65 auf, der wir bis zu den
Wassersteinen folgen. Weitere Hinweise: Nach einer Weile
verlässt
und dem Schild mit der forstwirtschaftlichen Zwecken dienenden Nummer
64. Etwas später taucht auch die Nr. 65 auf, der wir bis zu den
Wassersteinen folgen. Weitere Hinweise: Nach einer Weile
verlässt  unseren Weg. Dort wo der Weg
unseren Weg. Dort wo der Weg  scharf
links abbiegt und zur Ruine Erfenstein führt, geht man geradeaus weiter, auch auf Weg Nr. 2, der
jedoch kurz darauf nach rechts abbiegt. Ca. 10 m dahinter entdeckt man
linkerhand sogar den Wegweiser
scharf
links abbiegt und zur Ruine Erfenstein führt, geht man geradeaus weiter, auch auf Weg Nr. 2, der
jedoch kurz darauf nach rechts abbiegt. Ca. 10 m dahinter entdeckt man
linkerhand sogar den Wegweiser  ,
der auch auf die forstamtliche Ziffer 65 hinweist. Dort, wo der Weg
durch Abholzung eines beidseitigen Streifens lichter wird,
stößt man auf die Wassersteine links und rechts des Weges.
Linkerhand auf einem Felsen weist eine Inschrift den Weg zu den
größeren Wassersteinen. Zugegeben: Die Steine sind keine
besondere Sehenswürdigkeit. Aber die vielen kleinen und dennoch
interessanten Dinge bereichern den Pfälzerwald.
,
der auch auf die forstamtliche Ziffer 65 hinweist. Dort, wo der Weg
durch Abholzung eines beidseitigen Streifens lichter wird,
stößt man auf die Wassersteine links und rechts des Weges.
Linkerhand auf einem Felsen weist eine Inschrift den Weg zu den
größeren Wassersteinen. Zugegeben: Die Steine sind keine
besondere Sehenswürdigkeit. Aber die vielen kleinen und dennoch
interessanten Dinge bereichern den Pfälzerwald.
Um nicht bis zum Abzweig des Weges  zurückgehen
zu müssen, sind wir auf dem Weg 65 weitergewandert. Er
schlängelt sich abwärts, vorbei an einem Hochsitz zur Linken
und dem Abzweig 65 i. Am Abzweig 65 j geht's links ab, aber nicht auf
dem Weg direkt vor dem Baum mit dem Schild, sondern den
grasbewachsenenen nicht so gut erkennbaren Weg davor. Es ist ein nicht
befestigter, auch von Wildschweinen aufgewühlter
schneisenähnlicher Weg, der steil hinunter führt, aber
dennoch einigermaßen gut zu begehen ist. Er stößt auf
eine Kreuzung, man geht abwärts und erreicht den 3-Burgen-Rundweg,
auf dem man nach links abzweigt. Schon hat man den imposanten
Bergfried im Blickfeld. Diese beiden Seiten, Seite 1, Seite 2, informieren über die Burg.
zurückgehen
zu müssen, sind wir auf dem Weg 65 weitergewandert. Er
schlängelt sich abwärts, vorbei an einem Hochsitz zur Linken
und dem Abzweig 65 i. Am Abzweig 65 j geht's links ab, aber nicht auf
dem Weg direkt vor dem Baum mit dem Schild, sondern den
grasbewachsenenen nicht so gut erkennbaren Weg davor. Es ist ein nicht
befestigter, auch von Wildschweinen aufgewühlter
schneisenähnlicher Weg, der steil hinunter führt, aber
dennoch einigermaßen gut zu begehen ist. Er stößt auf
eine Kreuzung, man geht abwärts und erreicht den 3-Burgen-Rundweg,
auf dem man nach links abzweigt. Schon hat man den imposanten
Bergfried im Blickfeld. Diese beiden Seiten, Seite 1, Seite 2, informieren über die Burg.
Auf Steinstufen aufwärts gelangten wir
in den aufgeschütteten Halsgraben von Alt-Erfenstein. Wer auf den
Felsen mit den Überresten des Bergfrieds hinauf möchte, muss
klettern. Nur Uwe wagte es. Wir stiegen wieder ab und weiter hinunter
zunächst in den zum Teil verschütteten Halsgraben
der unteren und größeren Burg, durch den der Weg
führt. Linkerhand im Halsgraben, der die Bergseite der Burg
U-förmig umschließt, sollen die Reste einer Zugbrücke
zu sehen sein, berichten Klaus und Thomas Frölich in der
Broschüre des Pfälzerwald-Vereins Kaiserslautern aus dem Jahr
2003: "Wenig bekannte Burgen in der Pfalz". Auch diese Ruine
besaß offenbar neben der Burg auf dem Felssporn eine Unterburg,
zu der die Zugbrücke geführt haben soll. Der teils gemauerte
Halsgraben ist deutlich zu erkennen, Reste einer Zugbrücke konnten
wir leider nicht ausmachen. Die oben erwähnte Webseite 2
beinhaltet einen Grundriss, der einen informativen Einblick
in Lage und Bebauung der Burg gewährt.
Nach einer ausgiebigen Besichtigung der Oberburg stiegen wir ab nach
Erfenstein. Da wir offenbar alle noch nicht müde waren und noch
genug Zeit hatten, stiegen wir nochmals hoch zur Ruine Spangenberg, wo
wir im Restaurant unsere Abschlussdrinks zu uns nahmen. Von Erfenstein
aus brachte uns der Bus wieder nach Neustadt.
Nachtrag zu den Wassersteinen: Am Pfingstmontag, den 5. Juni 2017,
suchte ich nochmals die Wassersteine auf. Und siehe da: Der Schriftzug
auf dem Felsen war aufgefrischt und die Wassersteine blitzeblank
geputzt worden. Herzlichen Dank! Wie unsere Tageszeitung "Die
Rheinpfalz" am 13. Juni 2017 berichtete, haben Mitglieder des
Pfälzerwald-Vereins Esthal diese Aktion durchgeführt. Bei dem
Stein mit dem Schriftzug handelt es sich nicht, wie irrtümlich
berichtet, um einen Ritterstein, da er nicht im Rittersteinverzeichnis
aufgeführt ist. Über
die Entstehung der Wassersteine gehen lt. unserer Zeitung die Meinungen
weit auseinander. Ob sie dieselbe Geschichte haben wie die sog.
Gletschermulden auf dem Kesselberg? Über zwei verschiedene
Meinungen über die dortige Entstehung habe ich bei meiner Wegbeschreibung des Pfälzischen Königsweges, 8. Etappe, berichtet.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Rundwanderung am 15. April 2018
(Fotos von Heidrun Völkel und Alwin Müller, teilweise von den Vorwanderungen)
Route: Gemeindeplatz Esthal - Schelmenteichbrunnen - Goldbrunnen - Wolfsschluchthütte
- Museumswald auf der Kl. Ehscheid - Wolfsgrube bei Schwabenbach -
Erntsiegelbrunnen - Römerbrunnen - Gemeindeplatz Esthal. Teils
identisch mit dem Westteil des Brunnenwanderweges.
Kartenmaterial:
Neue Kartenserie "Naturpark Pfälzerwald" Maßstab 1:25.000
Oberhaardt von Neustadt/Wstr. bis zum Queichtal (Blatt NP6), 2. Aufl., 2010
-offizielle topografische Wanderkarten von PWV und LVermGeo-
Karte erhältlich in Buchhandlungen, PWV-Hütten oder bei der PWV-Geschäftsstelle in 67433 Neustadt, Fröbelstraße 24
Achtung: Die Kartenserie wird nicht mehr neu aufgelegt, wenn sie vergriffen ist.
Pietruska Rad-, Wander- und Freizeitkarte, Maßstab 1:25 000
Edenkoben, Landau & Neustadt, 2. Auflage 2013
Literatur: Grundschule Esthal, Die Trift im Breitenbachtal
Walter Eitelmann, Rittersteine im Pfälzerwald, 5. Auflage.
Pfälzerwald-Verein Neustadt an der Weinstraße, ISBN
3-00-003544-3
13 Wanderer
machten sich bei schönstem Wetter auf den Weg von der
Bushaltestelle am Gemeindeplatz in Esthal. Hier gibt es eine Tafel, die
über den Brunnenwanderweg informiert, und bereits 2 Brunnen, einen
Springbrunnen und einen Tiefbrunnen, der nicht mehr in Betrieb ist.
Etwas weiter südlich in der Verlängerung der
Brunnenstraße mit bei Nässe sehr glattem Kopfsteinpflaster
entdeckten wir den Schelmenteichbrunnen.
Die meisten Brunnen um Esthal waren Wasch- und Viehtränkebrunnen
und dienten der Bewässerung der Felder. So auch der
Schelmenteichbrunnen. Diese Seite
der Gemeinde Esthal gibt Infos über den Brunnen und erklärt
die Namensherkunft. Unterhalb befand sich nämlich ein Teich, zu
dem Schelme (Diebe) gebracht und mittels eines Hebels so lange
untergetaucht und wieder hochgehievt wurden, bis sie ihre Schuld
bekannten und versprachen, nie wieder Unrecht zu tun.
Wir wanderten weiter auf diesem Weg, der im Tal die Straße bzw.den markierten
Wanderweg zur Wolfsschluchthütte quert und dann etwas oberhalb des
Talgrundes verläuft. Auf schmalem Pfad stiegen wir sodann zum Goldbrunnen ab.
Dieser zweigeteilte Brunnen links und rechts des Info-Steins ist
eigentlich eine Quelle. Besonders im linken Teil sieht man schön
das Wasser aus dem lockeren Sandboden, kleine runde Sandhügel
bildend, hervorquellen. Die Namensherkunft bleibt der Fantasie
überlassen.
 |
 |
Links: Die nicht vollständige Gruppe am Schelmenteichbrunnen - rechts: Der Goldbrunnen
Nun gingen wir im Talgrund, direkt am Breitenbach entlang, zurück.
Ein idyllisches urwaldähnliches Waldstück begeisterte uns.
Der Pfad und der in niedrige Mauern eingefasste begradigte Bach
fügen sich hervorragend in die Natur ein, zumal die Mauern teils
zerfallen und üppig von Moos überwachsen sind. Es handelt
sich nämlich um eine ehemalige Triftanlage, die hier von Anfang
des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts betrieben wurde.
Wir stießen auf eine Vertiefung zur Linken, die kein Wasser mehr
enthaltende Mühlbrunnenklause. Klause ist das pfälzische Wort
für das bayerische Woog. Auf dem Foto unten links erkennt man am
Ende des Woogs eine getreppte Mauer, in deren Mitte die Bohlenwand
eingefügt war, mittels derer man durch herausziehen der einzelnen
Bohlen das Wasser dosiert abgeben konnte, damit die Holzstämme zur
Weiterbeförderung genügend Schwung bekamen. Kurz vor dem Woog
fällt eine Verzweigung des Baches auf. Denn das Holz konnte mit
dem Bach entweder in den Woog oder daneben, praktisch als Bypass,
weitergeleitet werden. Das machte Sinn, denn die ins Wasser geworfenen
Stämme mussten von ca. 2 Dutzend Triftknechten begleitet werden,
die mit langen Stangen sich verkantendes Holz wieder gerade richteten.
Das funktionierte nur bei Tag. Wenn der Abend nahte, wurden die
Stämme im Woog "geparkt".
Wir erreichten ein Stauwerk mit zwei Stahldeckeln am Boden. Das diente
früher der Wasserversorgung von Esthal. Heute versorgt die
gefasste und eingezäunte Mühlbrunnenquelle zur Linken
das Dorf. Wir stießen auf die Asphaltstraße, die von Esthal
herunterkommt, passsierten die Kläranlage und erreichten die
Wolfsschluchthütte zur frühen Mittagseinkehr.
Links: Mühlbrunnenklause ohne Wasser - Mitte: Triftbach - rechts: Tafel im Museumswald
Danach stand ein weiteres Schmankerl auf dem Programm, der Museumswald
auf der Kleinen Ehscheid. Hierzu wanderten wir auf dem Weg nach
Breitenstein weiter, überquerten auf einem Steg den Bach Richtung
Schwabenbach und Naturfreundehaus. Aber wir nahmen den zunächst
parallel verlaufenden Forstweg links daneben, stießen oben auf
der Kl. Ehscheid auf den grün/blau und grün/weiß
markierten Weg Nr. 7, um rechts zu einer Hinweistafel zu gelangen. Auf
dem vergrößerten Foto rechts oben ist der Text gut zu lesen,
sodass ich nur noch folgendes hinzufügen möchte: Nach dem 2.
Weltkrieg dezimierten die Franzosen den Baumbestand im Pfälzerwald
durch massiven Holzeinschlag im Rahmen der Reparationszahlungen. Dabei
verließen sie sich offenbar auf die Angaben der hiesigen
Förster. Nun soll laut Überlieferung der Förster den
alten Baumbestand auf der Kl. Ehscheid entweder versehentlich oder
absichtlich verschwiegen haben. Wie auch immer, die alten Bäume
waren gerettet.
Links: Mächtige Bäume im Museumswald - Mitte: Diese Kiefer hat 3 m Umfang - rechts: Wolfsgrube bei Schwabenbach
Nun unternahmen wir einen Abstecher nach rechts gleich bei der Tafel,
um die mächtigen Bäume besser bestaunen zu können. Nach
einem Halbrund erreichten wir wieder den markierten Weg und alsbald
eine schöne Sitzgruppe, die zum Rasten einlädt. Auf dem Weg
Nr. 7 bleibend entdeckt man den Ritterstein Wolfsgrube, Nr. 107 in
Walter Eitelmanns Rittersteinbuch. Gleich links daneben befindet sich
die nicht mehr so tiefe, aber noch erkennbare Wolfsgrube, in der
Köder oder lebende Tiere die Wölfe zum Hineinspringen
anlockten. Mit dem Begriff "Wolfsgrube" können heutzutage viele
Menschen nichts mehr anfangen, dabei wurde erst 1908 der letzte Wolf im
Pfälzerwald erlegt.
Auf dem Weg Nr. 7 bleibend erreichen wir mit einem kleinen Abstecher
nach rechts den Erntsiegelbrunnen mit offenbar unbekannter
Namensherkunft. Nun waren wir wieder auf dem Brunnenwanderweg, der nach
dem Abstecher auf einem Pfad links hinaufführt. Nicht rechts
Richtung Wolfsschluchthütte hinuntergehen!
 |
 |
Links: Erntsiegelbrunnen - rechts: Römerbrunnen
Zwischenzeitlich bot sich ein schöner Blick auf Esthal, bevor wir
oberhalb des Goldbrunnens auf dem Forstweg mit der Markierung
weiß/grün und Nr. 8 weiterwanderten und somit auf der linken
Bachseite blieben, ehe wir rechts der Nr. 8 folgend hochgingen und
auf höherem Niveau zurück bis wir wieder den Brunnenwanderweg
erreichten, der steil links hoch den Weg zum Römerbrunnen wies.
Nun blieben wir auf dem Brunnenwanderweg, zunächst ein
längeres heidebewachsenes Stück. Der Weg führt vor einer
langen Linksschleife rechts ab, was leicht übersehen werden kann,
weil er nur in der Gegenrichtung markiert ist. Wir erreichten wieder
die Straße, die wir anfangs gequert hatten, und statteten noch dem Nebelsbrunnen einen
Besuch ab, bevor wir über die Bergstraße den Ausgangspunkt
wieder erreichten.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
Rundwanderung am 06. Mai 2018
(Fotos von Heidrun Völkel und Alwin Müller)
Route:
Altes Forsthaus Esthal - Spitzensteiner Tal - Kl. Pflasterberg -
Taubenplatz - Hengstental - Wögelbrunnen - ASV Sportheim -
Tränkenbrunnen - Traufelsbrunnen - Dörrenberg - Felsen
oberhalb der Sattelmühle - Altes Forsthaus Esthal. Teils
identisch mit dem Ostteil des Brunnenwanderweges.
Kartenmaterial:
Neue Kartenserie "Naturpark Pfälzerwald" Maßstab 1:25.000
Oberhaardt von Neustadt/Wstr. bis zum Queichtal (Blatt NP6), 2. Aufl., 2010
-offizielle topografische Wanderkarten von PWV und LVermGeo-
Karte erhältlich in Buchhandlungen, PWV-Hütten oder bei der PWV-Geschäftsstelle in 67433 Neustadt, Fröbelstraße 24
Achtung: Die Kartenserie wird nicht mehr neu aufgelegt, wenn sie vergriffen ist.
Pietruska Rad-, Wander- und Freizeitkarte, Maßstab 1:25 000
Edenkoben, Landau & Neustadt, 2. Auflage 2013
Wir
starteten am Restaurant Altes Forsthaus an der K 23 nach Esthal. Die
Bushaltestelle heißt immer noch Feuerwehr-Schulungsheim, obwohl
dieses längst vergangenen Zeiten angehört. Zunächst
wanderten wir auf Forstweg ins Spitzensteiner Tal. Der Name rührt
daher, dass es hier einen offenbar spitzgeformten Menhir gab, der 1787
urkundlich erwähnt und 1873 beim Bau der Kreisstraße
zerstört wurde. Schüler der Grundschule Esthal errichteten
2004 am Anfang des Gr. Pflastertals einen neuen "Spitzen Stein". Siehe auch weiter unten unter "Denk - Mal"-Steine.
Am Ende des hinaufführenden Tales bogen wir
auf dem Querweg links ab, um alsbald auf einem leicht zu
übersehenden Pfad rechts weiter aufwärts zu streben. Einige
Hindernisse unterzogen uns Sonderprüfungen. An einem
umgestürzten Baum mussten wir etwas den Hang hinaufklettern, um an
einer ein wenig leichteren Stelle das dichte Geäst zu
überwinden. Siehe Foto unten links. Ich versprach, dass dies das
schwerste Hindernis des gesamten Weges ist.
 |
 |
Foto links oben: Sonderprüfung - rechts oben: Ein "Denk-Mal"-Stein
Am
Ende dieses Pfades erreichten wir eine Hütte der Gemeinde Esthal,
die man mieten kann. Ein paar Meter unterhalb plätschert direkt am
Weg ein Brunnen. Ein paar Meter links, und wir befanden uns auf dem
grün/weiß markierten Weg von Neidenfels nach Esthal. Hier
steht rechterhand einer dieser "Denk -Mal"-Steine aus dem
Steinsetzungsprojekt von Schülern der Verbandsgemeinde Lambrecht
in Zusammenarbeit mit u.a. der Volkshochschule Lambrecht. Siehe auch unter Kulturjugend Frankeneck und Grundschule Neidenfels. Weitere Auskünfte erteilt Frau Pia Neumann von der Verbandsgemeinde Lambrecht.
Wir stießen auf einen Wiesenplatz mit einer Bank unter einem
Baum. Geradeaus, etwas ansteigend, wanderten wir über eine weitere
Grasfläche an einer kleinen Einzäunung vorbei, um links auf
einen schönen, nicht markierten, offenbar nicht mehr befahrenen
Forstweg auf dem Kl. Pflasterberg zu gelangen.
Beruhigend, wie das trockene Laub unter unseren Füßen
raschelte. Von rechts kam ein mit einer weißen Scheibe markierter
Weg hinzu, und so erreichten wir den Taubenplatz, eine Wegspinne, an
der viele Wege zussammentreffen. Einer davon, weiß/rot und
weiß/grün markiert, führt nach Esthal. Direkt, rechts
daneben, verläuft parallel ein ausgeprägter Hohlweg. Dieser
war ein Römerweg.
Wir wanderten westwärts auf einem nicht markierten Forstweg weiter
und stießen auf einen Weg in der Talsohle des Hengstentals, den
wir links hinuntergingen. Nach einigen Metern verlässt der Weg die
Talsohle nach links. Hier mussten wir zunächst weiterwandern, da
die Talsohle mit umgestürzten Bäumen versperrt ist. Wir
mussten aber wieder hinunter. Also blieb uns nichts weiter übrig,
als nach ein paar umgestürzten aber passierbaren
Nadelbäumen ein kleines Stück den Abhang hinunter zu
klettern. Hier ist der Weg wieder begehbar. Kurz darauf erblickt man
linkerhand eine Quelle. Nun darf man den rechts abzweigenden, nach oben
führenden Pfad nicht übersehen. Bald stießen wir auf
den Brunnenwanderweg, der uns zum Wögelbrunnen führte. Die Namensherkunft
dieses Brunnens kann man nicht erraten. Früher, vor dem Straßenbau, gab
es unterhalb einen kleinen Woog, also ein Wöglein oder Wögel, wie ihn
die Esthalter nannten. Die Web-Seite der Gemeinde gibt Auskunft über diesen Brunnen.
 |
 |
Links: Wögelbrunnen - rechts: Tränkenbrunnen
Ein paar Schritte über die Straße und wir konnten unsere
Mittagsmahlzeit im ASV Sportheim einnehmen. Gut und reichlich war's,
aber es dauerte lange, und so waren wir spät dran, als wir in der
Nähe, oberhalb des Wiesengeländes den Tränkenbrunnen mit
dem stattlichen Gemäuer unter der Straße aufsuchten. Auch
über diesen Brunnen gibt die Web-Seite der Gemeinde interessante Erläuterungen mit historischem Hintergrund in Text und Bild.
Wir wanderten nun zur Hauptstraße hinauf, gingen links ab und
wieder links die Friedhofstraße hinunter. Direkt hinter dem
Friedhof führte uns rechts ein Weg hinunter zur Kreuzung mit der
Beschilderung zum Straufelsbrunnen. Auf einem schönen schmalen Waldpfad gelangten wir auf die Forststraße in der Talsohle und rechts ab zum Brunnen.
 |
 |
Links: Am Straufelsbrunnen - rechts: Felsen am Kammweg
Den Abstecher zum alten Esthaler Steinbruch am Ende des Straufelstales
kurz vor der Kreisstraße musste ich fallen lassen, da es sonst zu
spät geworden wäre. Aber ein Schmankerl wollte ich den
Mitwanderern nicht vorenthalten, den Kammweg auf dem Dörrenberg.
Wir wanderten daher nicht die linke, sondern die rechte Seite des
Straufelstals hinunter, bogen gleich rechts in ein schönes
Seitental ab, den nächsten Weg links hoch, an der nächtsen
Gabelung links einen ebenen Weg ins nächste Seitental des
Straufelstals, in einer scharfen Linkskehre wieder den Weg hoch, um auf
dem nächsten Querweg links abzubiegen. Nun umwanderten wir im
Uhrzeigersinn auf einem schönen Fahrweg den Dörrenberg bis zu
einer grasigen Lichtung. Nun bogen wir über den linken Rand dieser
Lichtung weglos links ab und erreichten den vorerwähnten Kamm, der
anfangs schwach ausgeprägt ist. Aber wenn man einfach auf der
Höhe bleibt, kann man sich nicht verlaufen. Der parallel zum
Esthaler Tal verlaufende Kamm wird langsam, teils auf Trampelpfad,
felsiger. Die nicht sonderlich imposanten, recht kleinen Felsen sind
m.E. dennoch sehenswert. Schließlich sind sie auf der Karte (ohne
Namen) als Naturdenkmal gekennzeichnet. Am Besten umgeht man sie auf
etwas schwierigem Weg auf der rechten Seite. Nun konnten wir auf
die westlichsten Häuser von Frankeneck hinabblicken. Direkt unter
uns die Sattelmühle.
Wir waren also weit von Esthal entfernt, sodass ich mir auch nicht
sicher bin, ob der Kamm noch zum Dörrenberg gehört.
Ein Stück
weiter gelangten wir über ein paar Steinstufen wieder auf den
Forstweg. Es gab also offenbar einen offiziellen Weg zu den Felsen.
Links haltend erreichten wir sodann in entgegengesetzter Richtung
wieder das Alte Forsthaus, wo uns die Wirtsleute, obwohl geschlossen
war, mit Getränken versorgten. Wir waren sehr froh, dass wir die
Wartezeit auf den Bus nicht dürstend überstehen mussten.
 |
 |
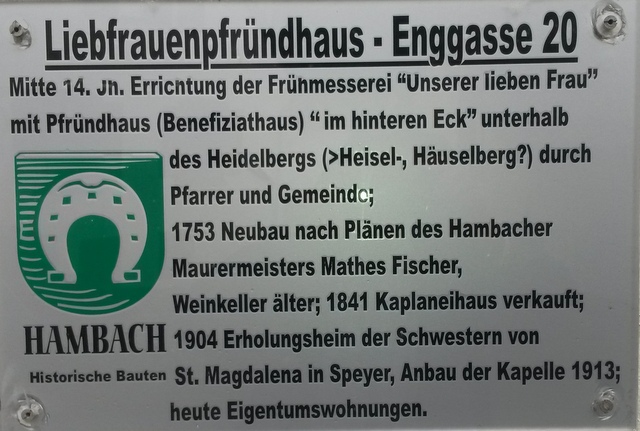



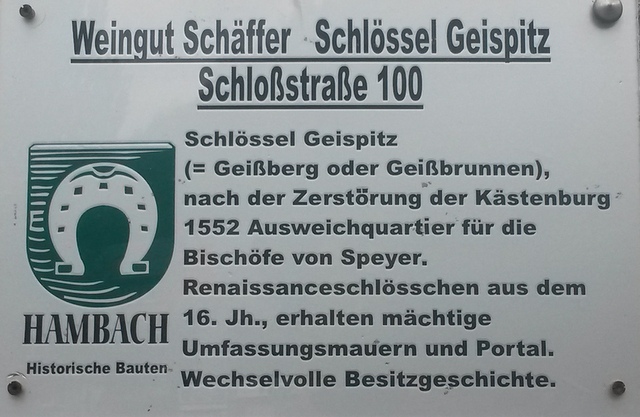

 zu erreichen. Das grüne Bänk'l passierten wir ohne Platz
zu nehmen. Wir erreichten den Römerweg, den wir gleich wieder
Richtung Afrikaviertel verließen, um nach wenigen Metern links
auf einen letzten schönen Pfad durch die ehemaligen Parkanlagen am
Nollen zu gelangen. Durch die Hauberallee und die Hauberanlagen
wanderten wir sodann zum Bahnhof.
zu erreichen. Das grüne Bänk'l passierten wir ohne Platz
zu nehmen. Wir erreichten den Römerweg, den wir gleich wieder
Richtung Afrikaviertel verließen, um nach wenigen Metern links
auf einen letzten schönen Pfad durch die ehemaligen Parkanlagen am
Nollen zu gelangen. Durch die Hauberallee und die Hauberanlagen
wanderten wir sodann zum Bahnhof.
 und
und  und dem Schild mit der forstwirtschaftlichen Zwecken dienenden Nummer
64. Etwas später taucht auch die Nr. 65 auf, der wir bis zu den
Wassersteinen folgen. Weitere Hinweise: Nach einer Weile
verlässt
und dem Schild mit der forstwirtschaftlichen Zwecken dienenden Nummer
64. Etwas später taucht auch die Nr. 65 auf, der wir bis zu den
Wassersteinen folgen. Weitere Hinweise: Nach einer Weile
verlässt  unseren Weg. Dort wo der Weg
unseren Weg. Dort wo der Weg  scharf
links abbiegt und zur Ruine Erfenstein führt, geht man geradeaus weiter, auch auf Weg Nr. 2, der
jedoch kurz darauf nach rechts abbiegt. Ca. 10 m dahinter entdeckt man
linkerhand sogar den Wegweiser
scharf
links abbiegt und zur Ruine Erfenstein führt, geht man geradeaus weiter, auch auf Weg Nr. 2, der
jedoch kurz darauf nach rechts abbiegt. Ca. 10 m dahinter entdeckt man
linkerhand sogar den Wegweiser  zurückgehen
zu müssen, sind wir auf dem Weg 65 weitergewandert. Er
schlängelt sich abwärts, vorbei an einem Hochsitz zur Linken
und dem Abzweig 65 i. Am Abzweig 65 j geht's links ab, aber nicht auf
dem Weg direkt vor dem Baum mit dem Schild, sondern den
grasbewachsenenen nicht so gut erkennbaren Weg davor. Es ist ein nicht
befestigter, auch von Wildschweinen aufgewühlter
schneisenähnlicher Weg, der steil hinunter führt, aber
dennoch einigermaßen gut zu begehen ist. Er stößt auf
eine Kreuzung, man geht abwärts und erreicht den 3-Burgen-Rundweg,
auf dem man nach links abzweigt. Schon hat man den imposanten
Bergfried im Blickfeld. Diese beiden Seiten, Seite 1, Seite 2, informieren über die Burg.
zurückgehen
zu müssen, sind wir auf dem Weg 65 weitergewandert. Er
schlängelt sich abwärts, vorbei an einem Hochsitz zur Linken
und dem Abzweig 65 i. Am Abzweig 65 j geht's links ab, aber nicht auf
dem Weg direkt vor dem Baum mit dem Schild, sondern den
grasbewachsenenen nicht so gut erkennbaren Weg davor. Es ist ein nicht
befestigter, auch von Wildschweinen aufgewühlter
schneisenähnlicher Weg, der steil hinunter führt, aber
dennoch einigermaßen gut zu begehen ist. Er stößt auf
eine Kreuzung, man geht abwärts und erreicht den 3-Burgen-Rundweg,
auf dem man nach links abzweigt. Schon hat man den imposanten
Bergfried im Blickfeld. Diese beiden Seiten, Seite 1, Seite 2, informieren über die Burg.